Die Stunde der Folk Devils – Interview mit Benjamin Opratko
Der Politikwissenschaftler Dr. Benjamin Opratko forscht zu Rassismus, Populismus, Autoritarismus und politischer Theorie. Im Interview erklärt er, wie kulturelle Figuren zu Magneten politischer Polarisierung werden, auf welche Weise Gesellschaften in Krisenzeiten ihre inneren Widersprüche verarbeiten und inwiefern Muster derzeitiger Kulturkämpfe denen faschistischer Agitationen der 1930er Jahre ähneln.
Kathrin Ottovay (KO): Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir über Kulturkämpfe reden?
Benjamin Opratko (BO): Der Begriff ist unbestimmt und vieldeutig – und ich glaube, dass das auch den Kern seiner Attraktivität ausmacht. Man verwendet ihn, weil man zu wissen glaubt, was gemeint ist. Das funktioniert aber nur, wenn das Gegenüber die richtigen Assoziationsketten mitbringt. Wenn man Kultur aber mit den klassischen Cultural Studies als way of life begreift, lassen sich Kulturkämpfe als Konflikte um Lebensweisen verstehen. Solche Auseinandersetzungen sind keineswegs neu. Entscheidend ist vielmehr, welche Lebensweisen wann und wo und von wem zum Problem erklärt werden, also an welchen Themen sich die Kämpfe entzünden.
Julian Schmitzberger (JS): Hattest du in deiner eigenen Forschung mit solchen Konflikten zu tun?
BO: In meiner Dissertation ging es um die Funktionen des antimuslimischen Rassismus, also um seine Funktion in den Auseinandersetzungen um gesellschaftliche Hegemonie. In diesem Zusammenhang bin ich auf die Theoriebezüge der Cultural Studies gestossen. Aus den frühen Arbeiten von Stanley Cohen zu Subkulturen wie den Mods oder Rockern habe ich den Begriff des Folk Devils aufgegriffen, der dann auch in Policing the Crisis von Stuart Hall und Kollegen eine zentrale Rolle spielt. Folk Devils sind kulturelle Figuren, um die herum sich Antagonismen ausbilden und Moralpaniken organisieren lassen. Sie lassen sich häufig als Effekt erfolgreicher politischer Initiativen der Rechten analysieren. Diese Folk Devils verkörpern alles, was man für lamentabel, gefährlich oder ekelhaft in der Welt hält. Bei der Figur des Muslims, der Muslima finden ähnliche Prozesse statt. Hier spielen die sogenannten Kulturkämpfe eine wichtige Rolle, weil autoritäre Parteien und Politiker anhand dieser Figuren das Ressentiment organisieren.
JS: Was hat sich verändert seit deiner Forschung zu antimuslimischem Rassismus? Was prägt heutige Kulturkämpfe?
BO: Das Figurenkabinett, das in der Erzählung der Rechten eine zentrale Rolle spielt, wurde weiter ausgebaut: Neben Muslim:innen, Migrant:innen und Geflüchteten stehen da jetzt auch etwa Grüne, Radfahrer:innen, Feminist:innen oder Transpersonen. Man erkennt daran die zunehmende Bedeutung von Klimapolitik und Queerness. Bemerkenswert ist da eine Parallele zwischen dem antimuslimischen Rassismus der 2000er bis 2010er Jahre, den ich untersucht habe, und der aktuellen transfeindlichen Politik: Sowohl die Figur des Muslims wie auch die der Transperson ermöglichen transversale Verbindungen zwischen rechtsextremen, rechten, konservativen und liberalen Positionen – bis hinein in Teile der Linken. An Themen wie Migration und Gender richten sich politische Organisationen und Öffentlichkeiten gerade ein Stück weit neu aus. Ich würde nicht einfach von einer Spaltung in zwei Lager sprechen, wie es oft angeführt wird. Der Prozess ähnelt eher dem Vorgang, wenn man mit einem Magnetstab in Feilspäne aus Eisen hineinfährt: Um den polarisierenden Magneten organisieren sich Partikel plötzlich anders, sie liegen auf eine andere Weise da als vorher
JS: Wie erklärst du dir den aktuellen Aufschwung kulturkämpferischer Muster?
BO: Das beruht sicherlich auch auf einem steigenden Krisendruck. Dieser Druck entsteht zum einen dadurch, dass gesellschaftlich eingeübte Abläufe, die Zirkulationsweisen des Lebens, unterbrochen werden, sei es durch Veränderungen des Klimas, der Migrationsbewegungen oder der Kapitalakkumulation. Es gibt mehr zu erklären, wenn sich Krisenmomente verstärken. Wir erleben eine tiefe, globale gesellschaftliche Krise, die erstmals in der Wirtschaftskrise von 2008 an die Oberfläche getreten ist. Mit dem Philosophen Antonio Gramsci kann man solche Ereignisse als Elemente einer organischen Krise begreifen und die historische Phase, in der wir gerade leben, als Interregnum, als eine Übergangszeit. Zumindest historisch betrachtet war es so, dass in solchen Interregnumsphasen autoritäre politische Angebote, die versprechen, mit Gewalt Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, an Attraktivität gewann. Das war zu Gramscis Lebzeiten die faschistische Option. Sie ist auch heute wieder präsent, als organisierte Zurückdrängung von Demokratie und den Errungenschaften sozialer Kämpfe, bis hin zu Ausschaltungs- und Zerstörungsphantasien.
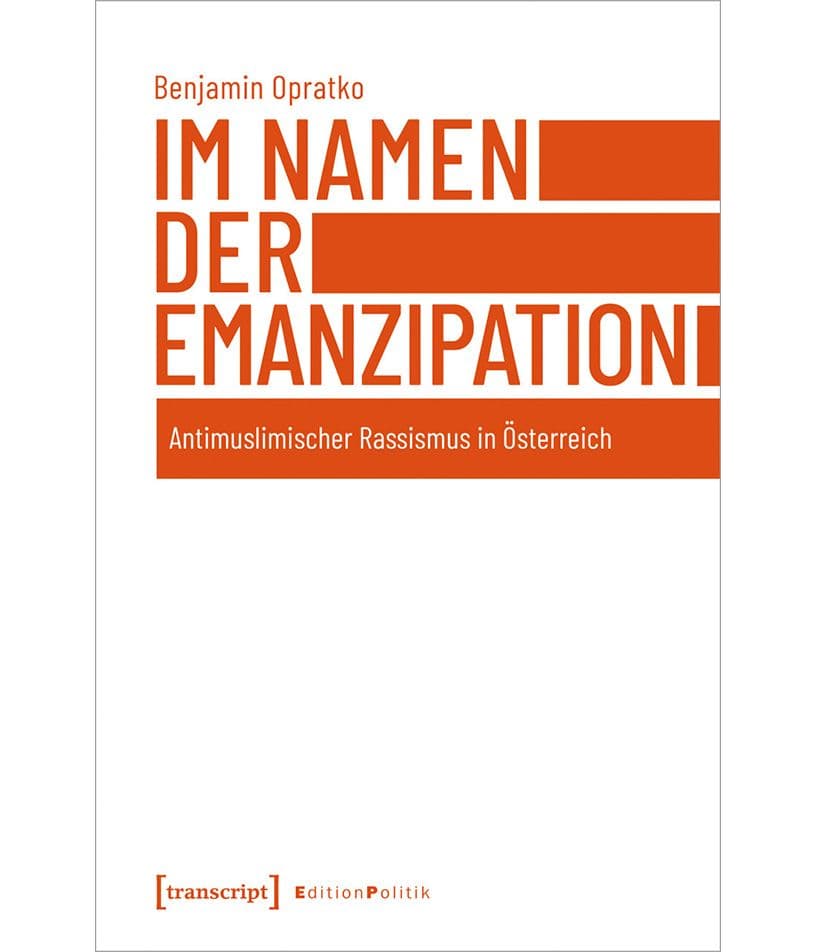
KO: Was haben heutige Kulturkämpfe mit den politischen Entwicklungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu tun?
BO: Je mehr ich mich mit der gegenwärtigen Konjunktur beschäftige, desto weiter schaue ich manchmal historisch zurück. Tatsächlich finde ich die Bezüge zu den 1920er und 1930er Jahren aktuell erhellender als jene zur Krise der 1970er, über die Hall und die britischen Cultural Studies geschrieben haben. Der Aufstieg faschistischer Bewegungen damals hatte zwar ganz andere Voraussetzungen, aber es lassen sich ähnliche Muster erkennen. Faschistische Kräfte haben sich, damals wie heute, nicht nur als eigenständige Bewegung, sondern auch innerhalb etablierter politischer Lager gebildet. In Wien, wo ich mich gerade befinde, war die Geschichte der 1920er und 1930er Jahre von erbittert ausgetragenen Kulturkämpfen geprägt. Hier hat sich die faschistische Option zunächst innerhalb der damals christlich-sozial genannten Partei durchgesetzt: Der erste Faschismus in Österreich war nicht der Nationalsozialismus, sondern der Austrofaschismus, der 1934 mit einem Bürgerkrieg die Macht ergriff.
KO: In deinen aktuellen Texten verweist du auf Leo Löwenthals Studien zum Autoritarismus, die vor mehr als 70 Jahren veröffentlicht wurden. Inwiefern sind diese heute hilfreich?
BO: Die Hegemonietheorie nach Gramsci, mit der ich viel arbeite, fragt danach, wie die Herrschenden sich als führende Klasse organisieren und wie es ihnen gelingt, Konsens unter den Beherrschten herzustellen. Was Gramsci aus meiner Sicht nicht eingehend berücksichtigt hat, ist die Frage, welche subjektiven Energien in diesem Prozess wirken, wie es also dazu kommt, dass sich ein politisches Angebot gut oder richtig anfühlt und angenommen wird. Das hat die frühe Kritische Theorie wiederum besonders interessiert. Ich finde den Ansatz von Löwenthal interessant, der in seinem Buch Falsche Propheten faschistische Agitatoren in den USA der 1930er Jahre untersucht hat. Sein Interesse galt der Frage, was deren grosse Reden auf öffentlichen Plätzen mit der zuhörenden Menge gemacht hat. Löwenthal prägte für diese Art der Agitation einen nützlichen Begriff: Umgekehrte Psychoanalyse. Der Ausgangspunkt einer Psychoanalyse ist klassischerweise ein innerer Konflikt oder ein Leidensdruck. Das Ziel der Therapie ist, das Unerträgliche, das man erlebt hat, aufzuarbeiten und es dadurch etwas erträglicher zu machen…
KO: …und faschistische Agitation ist so etwas wie psychoanalytische Therapie unter umgekehrten Vorzeichen?
BO: Gewissermassen. Die damaligen Agitatoren beriefen sich darauf, dass etwas nicht funktioniert, dass man unzufrieden sein sollte, dass etwas unerträglich ist. Und dann taten sie das genaue Gegenteil einer Psychoanalyse: Sie versuchten nicht nur zu verhindern, dass die Ursachen des Problems durchdrungen werden, sondern sogar die Leidenssymptome zu verstärken. Mit dem Ziel, dass sich das Subjekt in diesem Symptom einrichtet, dass es gar nicht mehr ausserhalb dessen existieren kann und möchte. Und dieses Ressentiment, dieser Hass und dieser Ekel ermöglichen letztlich auch die faschistische Gewaltausübung (Weitereführendes hier; Anm. d. Red.).
JS: Und dieses Prinzip lässt sich auch heute beobachten?
BO: Wenn ich mir beispielsweise weite Teile der Presse in Deutschland ansehe, dann wird da oft in diesem Sinne Agitation betrieben: Es herrschen Angstlust, Ekel, Abscheu, es wird eine umfassende Atmosphäre der Bedrohung produziert.
JS: Und hier werden Folk Devils geschaffen.
BO: Genau. Wenn wir den Begriff des Kulturkampfes nun auf diese Form der Agitation eng führen, dann können wir beobachten, dass er sich um Figuren organisiert – mit dem mittelfristigen sozialen und politischen Effekt der Enthemmung und Legitimierung von Gewalt. Diese muss nicht persönlich ausgeübt werden, es reicht, sie für richtig oder notwendig zu halten. Es kann Gewalt sein, die medial vermittelt wird, die an den Aussengrenzen Europas ausgeübt wird, im Mittelmeer oder in Osteuropa, oder in Gaza. Was dabei auch passiert ist die Ausbildung eines Körperpanzers, wie es Klaus Theweleit genannt hat, oder einer walled subjectivity, wie es Wendy Brown bezeichnet, also eine Art Verhärtung der Subjektivität.
JS: Zum Befund der Verhärtung kamt ihr auch in eurem Forschungsprojekt zu Ablehnungskulturen beziehungsweise cultures of rejection, das du gemeinsam mit Manuela Bojadžijev und anderen durchgeführt hast.
BO: In unserem Projekt haben wir in mehreren europäischen Ländern zur Frage geforscht, was die sozialen und kulturellen Voraussetzungen für die Attraktivität autoritärer Politik sind. Dazu haben wir unter anderem mit Menschen gesprochen, die in Logistikbetrieben, Warenlagern oder im Einzelhandel arbeiten. Viele dieser Personen haben sich eine Art Panzer zugelegt, um die Zumutungen des Arbeits- und des Alltagslebens zu verarbeiten. Damit geht oft auch einher, dass sie eine enorme Härte gegen andere entwickelt haben. Obwohl die meisten eine eigene Migrationsgeschichte hatten, war es die Figur des Flüchtlings, auf die diese Härte projiziert wurde. Statt gegen die Zumutungen als solche anzugehen, werden diese dann paradoxerweise so umgedeutet, dass man stolz darauf sein kann, sie zu ertragen. Zugleich wird ein Ressentiment gegen jene geschürt, von denen man glaubt, dass sie das selbst nicht auf sich nehmen würden: Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger:innen und Flüchtlinge. Dem dominanten Narrativ zufolge bekommen diese Gruppen etwas, das ihnen nicht zusteht, weil sie sich angeblich den Zumutungen nicht aussetzen, denen man sich selbst ausgesetzt sieht.
KO: Was erwarten diese Menschen von Politik oder Gewerkschaften?
BO: Das vorherrschende Gefühl ist, dass man nichts gegen die Verhältnisse ausrichten kann. Die Interviewpartner:innen berichteten von ökonomischem Druck und Angst vor Altersarmut. Das waren überwiegend Menschen, die für sehr harte, anstrengende und monotone Arbeit, die kaum Autonomie zulässt, sehr wenig Geld verdienen. Wir haben festgestellt, dass dieser Bereich ihres Lebens, in dem sie mindestens acht Stunden am Tag verbringen, völlig ausgenommen war von der Vorstellung irgendeiner Form von Gestaltbarkeit. Dieser Befund deckt sich mit anderen Studien, etwa aus der Industriesoziologie. Wolfganz Menz und Sarah Nies etwa sprechen davon, dass nicht nur die Ansprüche der Beschäftigten nicht erfüllt, sondern die Ansprüche selbst erodieren. Wobei die Annahme, dass die Politik im Feld der Ökonomie und der Arbeit nichts ausrichten kann, ja von vielen politischen Akteur:innen selbst befördert wird. Was dann aber geschieht, ist, dass sie dafür an anderer Stelle Handlungsfähigkeit beweisen, etwa beim Schliessen der Grenzen, der Streichung der Unterstützung für Arbeitslose oder anderen staatlichen Leistungen. Die Erwartung an Gestaltungsfähigkeit von Politik wird also in einen Bereich verschoben, der strukturell zu Ungunsten der Machtunterworfenen ausgerichtet ist.
JS: Inwiefern wird eine solche politische Durchsetzungsfähigkeit bei den anderen Kulturkampfthemen demonstriert, wie beispielsweise zu Fragen von Genderidentitäten?
BO: Die Wahrnehmung der Welt als krisenhaft, in der sich alles zum Schlechteren verändert, öffnet die Tore für eine Agitation, die sagt: «Schaut her, es wird wirklich alles immer schlimmer, die Welt gerät komplett aus den Fugen!» In einer solchen historischen Situation kann die Geschlechterordnung als ultimativer Repräsentant für vermeintliche Stabilität herangezogen werden. Das Letzte, was viele noch zu wissen zu glauben, ist, dass doch wohl zumindest noch klar sei, wer eine Frau und wer ein Mann ist. Transfeindliche Akteur:innen übersetzen die Begehren von trans Menschen nach Freiheit und Anerkennung in ein Symptom der allgemeinen Unordnung und Dekadenz. Ansonsten kann mir niemand erklären, warum die Frage, wie viele Toiletten es in einer Einrichtung gibt und welche Symbole vorne draufstehen, so erbittert umkämpft ist. Jede Person, die in einen Zug steigt, ist damit einverstanden, dass es da Toiletten gibt, auf die halt alle gehen. Niemand hat jemals geschlechtergetrennte Bahn-Toiletten gefordert, oder? Höchstens funktionierende, wenn man mit der Deutschen Bahn unterwegs sein muss.
JS: Was bleibt in der Diskussion um Kulturkämpfe bisher unterbeleuchtet?
BO: Ich denke, der Diskussion um Kulturkämpfe würde es guttun, wenn man nicht so täte, als wären diese Muster erst mit dem Aufkommen der Sozialen Medien entstanden. Stattdessen könnte man sich beispielsweise mit historischen Arbeiten auseinandersetzen, die etwa politische Kämpfe früherer Jahrhunderte erforschen, die auch als «Kulturkämpfe» ausgetragen wurden. Was mir in der derzeitigen Debatte oft fehlt, ist historische Informiertheit und Tiefenschärfe.
KO: Das führt uns zu unserer Abschlussfrage: Welchen Beitrag zur Diskussion um Kulturkämpfe kann eine Wissenschaft leisten, die sich mit der Alltagskultur auseinandersetzt, wie die Empirische Kulturwissenschaft?
BO: Die Methode der Ethnografie ist besonders gut geeignet, um die subjektiven Formen der Krisenverarbeitung zu beschreiben und im besten Fall zu verstehen. Darüber hinaus braucht es auch die Verbindung zu anderen Disziplinen wie der Geschichts-, Sozial- und Politikwissenschaft und zu Zeitdiagnosen, die auf einer anderen Flughöhe entwickelt werden. Es geht nicht darum, diesen Analysen einfach zuzuarbeiten. Im Gegenteil: Die Aufgabe besteht auch darin, soziologische Grossdiagnosen, die in hoher Auflage gedruckt werden, herauszufordern, indem man sich an konkrete Orte begibt und konkrete soziale Zusammenhänge beforscht, in denen das alles stattfindet, was wir hier besprochen haben.
Zitation
Benjamin Opratko, Kathrin Ottovay, Julian Schmitzberger, Die Stunde der Folk Devils – Interview mit Benjamin Opratko, in: das.bulletin, 29.09.2025, URL: https://ekws.ch/de/bulletin/post/die-stunde-der-folk-devils-interview-mit-benjamin-opratko.
Benjamin Opratko

Kathrin Ottovay

